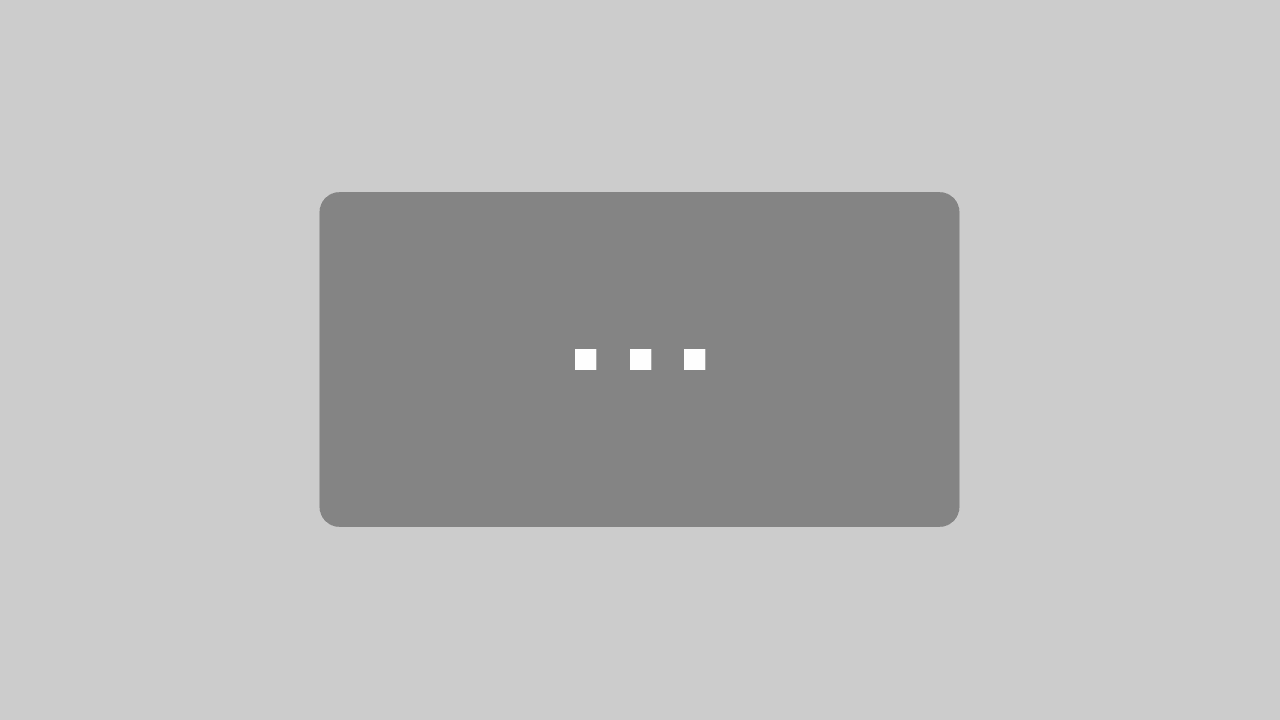Lesedauer: 9 Minuten
Vor einigen Wochen debattierte der Bundestag über die Errichtung eines Mahnmals der Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in der DDR. Viele Reaktionen waren vorhersehbar, andere erschreckend. Offensichtlich wurde das Problem der Linkspartei, sich von DDR und Kommunismus zu distanzieren. Doch nicht nur die Linken haben Schwierigkeiten mit diesem Thema. Auch der Durchschnittsbürger kommt beim Thema Linksextremismus ins Schlingern. Ein Mahnmal scheint überfällig.
Ein Glücksfall der Geschichte
Vor gut 30 Jahren brachten mutige Bürgerinnen und Bürger die Berliner Mauer zum Einsturz. Damit lehnten sie sich gegen eine repressive Diktatur auf – wohlgemerkt die zweite auf deutschem Boden im vergangenen Jahrhundert. Nach 40 Jahren war Schluss für Kommunismus, Bespitzelung und Stasi. Die Menschen der DDR träumten von Freiheit, von Einheit und von Demokratie. Es ist ein Glücksfall der deutschen Geschichte, dass mit den Demonstrationen im Herbst 1989 der Einheitsprozess von Deutschland in Gang gesetzt wurde – und dass sie nicht mit beispielloser Gewalt niedergeschlagen wurden wie in anderen Teilen der Welt.
Nach 40 Jahren Planwirtschaft und Ein-Parteien – Staat war das Ausmaß dieser Diktatur verheerend, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht. Kritiker und Gegner des Sozialismus reden oft und gerne davon, dass diese Wirtschaftsordnung noch niemals einen Erfolg verzeichnen konnte. Aber die Bilanz der DDR umfasste mehr als eine desolate Wirtschaftssituation. Über Jahrzehnte bespitzelte die Stasi unzählige Menschen in ihren privaten Wohnungen, sofern man in diesem System von Privateigentum sprechen kann. Unliebsame Kritiker wurden im besten Falle ausgebürgert und im schlimmsten Fall ermordet. Nicht nur im Grenzstreifen fanden viele ihr trauriges Ende.
Die alte Laier
Höchste Zeit also, dass auch den Opfern dieses brutalen Systems gedacht wird, anstatt immer nur das Versagen oder die Verbrechen führender Köpfe der DDR zu beklagen. Die Bundesregierung sah das kürzlich genau so und so brachten die Unionsfraktion und die SPD-Fraktion im vergangenen Dezember einen wichtigen Antrag in den Bundestag ein. Sie forderten darin die Errichtung eines Mahnmals, um der Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in Deutschland zu gedenken.
Selbstredend fielen in der nachfolgenden Debatte die längst totgedroschenen Phrasen zur DDR-Mangelwirtschaft und natürlich wurde auch die Linksfraktion mal wieder unreflektiert als SED 2.0 diffamiert. Deswegen lagen die Erwartungen hoch, was wohl die Rednerin aus den Reihen der Linken zu dem Antrag zu sagen hatte. Wer allerdings glaubte, die sonst so besonnene Abgeordnete Simone Barrientos würde sich sachlich mit dem Antrag der Regierungsfraktionen auseinandersetzen, der wurde schon bald eines besseren belehrt. Die Rede der Abgeordneten machte viel eher ein altes Problem erneut offensichtlich. Die Partei Die Linke hat in weiten Teilen ein Problem mit dem Linksextremismus – und das anscheinend auch auf Bundesebene.
Ein System mit Fehlern oder Fehler mit System?
Ich möchte hier keinem Abgeordneten des Bundestags gezielt unterstellen, ein Feind der Verfassung zu sein. Und ganz bestimmt wäre es unhaltbar, Abgeordnete der Linksfraktion dem linksextremen Spektrum zuzuordnen. Barrientos‘ Rede machte hingegen offensichtlich, dass es der Linken weiterhin schwerfällt, sich eindeutig von linksextremem Gedankengut zu distanzieren. So bezweifelte die Würzburger Abgeordnete doch allen Ernstes, dass es mit der DDR eine kommunistische Gewaltherrschaft gegeben hätte. Stattdessen stilisiert sie diesen Staat zu einem System mit vielen Fehlern. Ihrer Meinung nach überwogen die Fehler in diesem System wohl. Sie übersieht dabei getrost, dass das System der Fehler war.
Das Ansinnen der Menschen sei gewesen „eine bessere DDR“ herbeizuführen. Einverstanden. Eine andere DDR. Eine bessere DDR. Wie auch immer. Hauptsache ohne Mauer und Gesinnungshaft. Dann allerdings bezweifelt sie, dass eine friedliche Revolution eine Gewaltherrschaft hätte stürzen können. Einerseits verneint sie hier eindeutig die Existenz einer Gewaltherrschaft. Andererseits, und das mit Sicherheit unbewusst, verbreitet sie die These, dass Gewalt ein legitimes Mittel sei, um ein Regime zu stürzen. Beides wird dem Mut der ehemaligen DDR-Bürger nicht gerecht.
Extremismus im Selbstversuch
Barrientos‘ Äußerungen reihen sich nahtlos in die Äußerungen anderer Vertreter der Linkspartei ein. So bezeichnete die ehemalige NRW-Landtagsabgeordnete Bärbel Beuermann die DDR als einen legitimen Versuch, den Kapitalismus endgültig zu überwinden, natürlich nur „[a]us der Sicht der Menschen, die diesen Staat damals gegründet haben“. Für Sahra Wagenknecht handelte es sich bei den Ausschreitungen im Umfeld des G20-Gipfels in Hamburg vor knapp drei Jahren nicht um Linksradikale, sondern lediglich um krawallmachende Chaoten. Die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke übernimmt die Moderation einer Podiumsdiskussion über die Wege zum Kommunismus. Besonders brisant: An der Diskussion beteiligt sich auch die verurteilte RAF-Terroristin Inge Viett, die den tosenden Beifall, der ihr entgegenschwemmt, sichtlich genießt.
Die Linke spielt also gerne mit dem Feuer. Anstatt sich eindeutig vom äußersten linken Rand zu distanzieren, scheuen manche Mitglieder dieser Partei die Nähe zu Extremisten nicht. Wie soll man sich aber auch effektiv von etwas distanzieren, was bei vielen Menschen hilfloses Gedruckse verursacht?
Ich selbst habe den Selbstversuch gewagt. Ich habe Freunde und Bekannte gefragt, was für sie Rechtsextremismus bedeutete und warum sie ihn verurteilten. Die Antworten waren eindeutig. Mir wurden brennende Asylantenheime genannt, homophobe und rassistische Beleidigungen und die NS-Diktatur. Anschließend wiederholte ich die Frage in Bezug auf Linksextremismus. Die wenigsten konnten mir eine zufriedenstellende Antwort geben. Manche nannten als Beispiel noch die RAF, kaum jemand erkannte in der DDR eine linksextreme Apparatur.
Ein Meister der Tarnung
Ist der Linksextremismus also möglicherweise gar nicht so gefährlich wie viele uns das weismachen wollen? Mitnichten. Nur weil eine Gefahr nicht eindeutig als solche wahrgenommen wird, macht sie das nicht automatisch ungefährlicher. Das Gegenteil ist richtig. Gerade die Fähigkeit des Linksextremismus besonders gut im verborgenen agieren zu können, macht ihn so gefährlich.
Die Motivation rechtsradikaler Straftäter ist für viele offensichtlich: Sie glauben nicht, dass alle Menschen gleich viel wert sind, dass andere es womöglich verdient haben, angezündet und getötet zu werden. Viele von ihnen sehen sich von einer schieren Flutwelle an Migranten überrollt und wollen sich ihr heißgeliebtes Heimatland zurückerobern. Das klingt ziemlich hirnverbrannt. Und das ist es mit Sicherheit auch.
Der Motivation linksradikaler Straftaten hingegen können die wenigsten folgen. Auch wenn sie die Attacken von rechts scharf verurteilen, sie begreifen die Beweggründe dahinter viel eher ohne sie gutzuheißen. Wie oft las man von „unbelehrbaren Terroristen“, wenn bis vor einigen Jahren über die Freilassung der letzten inhaftierten RAF-Mitglieder diskutiert wurde? Diese Menschen sind nicht unbelehrbar oder gar wirr im Kopf. Es sind Überzeugungstäter. Einige von ihnen sind diesen Überzeugungen bis heute treugeblieben.
Ein immer wiederkehrender Traum
Soll das jetzt heißen, dass der Rechtsextremismus in der Gesellschaft eher akzeptiert wird als der Linksextremismus? Ganz bestimmt nicht. Das Manko der linken Revoluzzer ist schlicht und ergreifend, dass links schon immer viel abstrakter war als rechts. Die Rechten sprechen immerhin ein urmenschliches Bedürfnis an: die Bequemlichkeit.
Denn kein Mensch will sich verändern. Der Mensch hasst Veränderung. Rechtsextreme auch. Die AfD hat es doch nur deshalb so leicht, weil sie sich gegen jedwede Veränderung sperrt und sich nach der guten alten Zeit sehnt, wo sich niemand Sorgen machen musste. Diese Welt hat so allerdings noch nie existiert und wird auch niemals existieren.
Gerade heute wird immer mehr die Aktualität und Richtigkeit von Brechts Zitat mit dem Schoß und der Fruchtbarkeit offensichtlich. In Bezug auf den linken Extremismus versagt das Zitat allerdings. Der Grund dafür ist einfach erklärt: Während die Deutschen in den 1930ern mehrheitlich für die Nazis stimmten, wurde ihnen das sowjetische System im Folgejahrzehnt ungefragt übergestülpt.
Es wird höchste Zeit
Nach der Kapitulation von Nazi-Deutschland wurden manche Menschen als Mitläufer klassifiziert. Sie sind ein typisches Beispiel dafür, wie sich rechtsextremes Gedankengut in den Menschen hineinfressen kann, der davor vielleicht kein überzeugter Nazi war. Nach dem Zusammenbruch der DDR war eine solche Einteilung schwieriger. Die Aufarbeitung war freilich eine andere, wenn es sie überhaupt gab. Jemanden als typischen Mitläufer in der DDR zu bezeichnen ist fast unmöglich. Die meisten Menschen arrangierten sich über viele Jahre mit dem bestehenden System mit all seinen Nachteilen. Sie unterwarfen sich dabei wahren Überzeugungstätern.
Die Aufgabe eines Mahnmals für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft ist daher eine andere als eines solchen, das an den Holocaust erinnert. Ein Mahnmal für die Opfer des Kommunismus müsste vorrangig die Frage beantworten, warum eine Gesellschaft, in der alle gleich sind, keine erstrebenswerte Daseinsform ist.
Beim Rechtsextremismus sind sich die meisten einig: nicht nur der Genozid als letzte Konsequenz dieses Regimes ist verurteilungswürdig, sondern auch die menschenverachtende Ideologie dahinter. Beim Linksextremismus sind viele von einer solchen Einsicht noch weit entfernt. Sie beklagen die Auswüchse eines solchen Systems und sprechen von Mauertoten, Zwangsadoptionen und Gesinnungshaft. Dass auch hinter einer solchen Herrschaft eine völlig falsche und verbrecherische Ideologie steht, ist vielen nicht bewusst. Es wird höchste Zeit für ein Mahnmal.