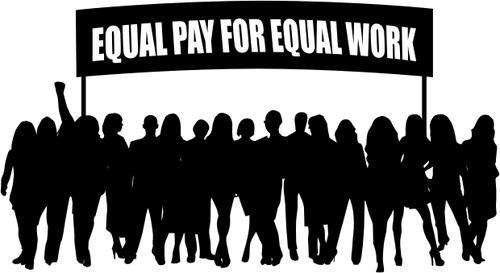Beitragsbild: moerschy, pixabay, Bildausschnitt von Sven Rottner.
Lesedauer: 13 Minuten
Viele Studenten erhalten BAFöG. Ursprünglich wurde das Fördermittel eingeführt, um Kinder aus einkommensschwachen Familien ein Studium zu ermöglichen. Gelungen ist das nur teilweise. Ein hoher bürokratischer Aufwand, zu geringe Fördersätze und die Angst vor frühzeitiger Verschuldung schreckt viele Studenten eher vom BAFöG ab. Eine Reihe von hartnäckigen Klischees trägt zusätzlich nicht gerade zum Sexappeal der Leistung bei. Höchste Zeit also, diese Klischees etwas näher zu betrachten…
Klischee #1: Das BAFöG ist ein wahrer Bürokratie-Dschungel.
Eines vorweg: Hinter dem BAFöG steckt tatsächlich eine komplizierte bürokratische Maschinerie. Wer die Fördermittel beantragt, muss daher die ein oder andere bürokratische Hürde in Kauf nehmen. Ob man allerdings von einem Dschungel aus Papierkram reden kann, halte ich für gewagt. Wie überall gilt auch beim BAFöG: Übung macht den Meister. Nach zig gestellten Anträgen und Änderungsanzeigen glaube ich, dass ich das System BAFöG zumindest in Teilen verstanden habe.
Auch für mich war dabei der Erstantrag der schlimmste. Zusätzlich zu den üblichen Formularen muss hier auch ein Lebenslauf angefertigt werden, der möglichst keine Lücken enthalten sollte. Die Ungewissheit, ob überhaupt BAFöG gewährt wird, ist für viele Erstis eine zusätzliche Belastung. Selten ist der Antrag bei Antragsstellung vollständig. Nachforderungen aufgrund fehlender Formulare oder Angaben ist nervenaufreibende Regel. Beantragt man das BAFöG zu spät, kann es sein, dass die erste Rate erst gegen Ende des ersten Semesters auf dem Konto eintrudelt.
Was die rechtzeitige Einreichung von Formularen besonders schwierig macht, ist die Abhängigkeit von anderen. Beim jetzigen BAFöG ist man zumindest von den Eltern abhängig. Das Amt möchte unter anderem stets den elterlichen Einkommenssteuerbescheid des vorletzten Kalenderjahrs. Da viele Wannabe – BAFöG-Bezieher eben nicht mehr bei den Eltern wohnen, kommt es gerade bei solchen Angaben häufig zu Verzögerungen.
Richtig tricky wird ein BAFöG-Antrag allerdings nur dann, wenn ein Student besonders außergewöhnliche Angaben zu machen hat. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Student ein bebautes Grundstück erbt. In diesem Fall kann der Papierkram tatsächlich leicht Überhand nehmen.
Das Gute an der Geschichte: Jeder Student ist nur für seinen eigenen Antrag verantwortlich. Die Mitarbeiter des BAFöG-Amts hingegen müssen hunderte dieser Anträge bearbeiten. Im Gegensatz zu diesem Bürokratie-Dschungel erscheint der eigene Antrag wie eine Lichtung im Wald.
Klischee #2: BAFöG lohnt sich nicht.
Nicht jeder theoretisch BAFöG-berechtigte beantragt BAFöG. Viele scheuen den hohen bürokratischen Aufwand, andere haben Angst, sich gleich zu Beginn des Studiums zu verschulden. Immerhin besteht das BAFöG seit Anfang der 1990er-Jahre jeweils zur Hälfte aus einem staatlichen Zuschuss und einem zinslosen Darlehen, das zurückgezahlt werden muss. Eigentlich eine nachvollziehbare Handhabung: Einerseits werden Studenten aus einkommensschwachen Familien gefördert, andererseits setzt das BAFöG Anreize, sich nach dem Studium tatsächlich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Trotzdem sinkt die Zahl der Studenten, die BAFöG erhalten. Gerade in den letzten Jahren war ein regelrechter Einbruch bei der Zahl der BAFöG-Empfänger zu beobachten. Im Jahr 2016 erhielten gerade einmal ein Fünftel der Studenten BAFöG, Tendenz weiter sinkend. Viele Studenten suchten sich parallel zum Studium lieber einen Nebenjob, um über die Runden zu kommen. Für diese Studenten ist es also attraktiver, gegebenenfalls länger zu studieren als mithilfe des BAFöG schneller zum Abschluss zu kommen.
Es liegt mir absolut fern, den Wert von Arbeit anzuzweifeln. Ich habe großen Respekt vor jedem, der sein Studium auch mit Nebentätigkeit erfolgreich abschließt. Ich selbst bin trotz BAFöG nebenher arbeiten gegangen. Das Geld wäre sonst knapp geworden. Ich verstehe Studenten, die aus diesem Grund noch mehr arbeiten, um sich ihr Studium (und ihr Leben!) unabhängig vom BAFöG zu finanzieren.
Allerdings haben solche Alternativen ihren Preis. Wer neben dem Studium arbeitet, schafft den Abschluss kaum in der Regelstudienzeit. Bei vielen anderen Studenten ist eine Finanzierung durch die Eltern meist auch nur begrenzt möglich. Und Hand auf’s Herz: Irgendwann hat man es satt, immer bei Mami und Papi die Hand aufzuhalten. Die am wenigsten lukrative Alternative ist der Studentenkredit: Man erhält einen beinahe beliebigen Batzen an Geld. Dieser muss jedoch komplett und zuzüglich Zinsen zurückgezahlt werden. Eine solche Verschuldung verdient das Prädikat „fahrlässig“.
Das BAFöG lohnt sich daher am ehesten für Studienanfänger. In den ersten Semestern ist man erst einmal gut damit beschäftigt, sich zurechtzufinden und die Spielregeln des Uni-Alltags zu verstehen. Nebenher noch arbeiten zu gehen, lässt viele Studenten am Sinn ihres Studiums zweifeln. Besteht Anspruch auf BAFöG, ist man diese Sorge zumindest zeitweise los.
Klischee #3: Das BAFöG ist reine Erbsenzählerei.
Beim BAFöG geht es ums Geld. Um sehr viel Geld. Wie bei jeder anderen Sozialleistung wird auch hier genau hingesehen. Wer BAFöG erhalten möchte, muss nicht nur die eigenen Hosen runterlassen, sondern die der Eltern, und gegebenenfalls von Geschwistern, gleich mit. Die meisten Angaben sind durch Belege zu untermauern. Einzureichen ist beispielsweise ein aktueller Kontoauszug, um etwaige Vermögensverschiebungen auszuschließen. Abgefragt wird auch das Barvermögen der Studierenden. Dabei handelt es sich allerdings um ein rechtliches Relikt. Keinen Sachbearbeiter hat es jemals gestört, wenn ich in besagtes Feld eine schlichte Null gesetzt habe.
Die Mitwirkungspflicht besteht nicht nur bei Antragsstellung, sondern während des gesamten Bewilligungszeitraums. Änderungen sind unverzüglich dem BAFöG-Amt mitzuteilen. Wer das versäumt, kommt schnell in Teufelsküche. Das bedeutet im besten Fall eine saftige Rückforderung und im schlimmsten Fall eine Strafanzeige wegen Betrugs.

Bild: moerschy, pixabay.
BAFöGlinge sollten also schon aus Eigeninteresse jeden Wisch dem Amt vorlegen. Dass bereits ein einziger zu viel verdienter Euro das Aus für das eigene BAFöG bedeutet, stimmt übrigens nicht. Die Nebeneinkünfte werden für ein ganzes Jahr berücksichtigt. Wer BAFöG erhält, kann problemlos 5.400 Euro im Jahr nebenher verdienen – theoretisch auch an einem einzigen Tag. Wer in einem Jahr allerdings mehr verdient, muss nicht automatisch um sein BAFöG bangen. Die Fördersumme wird mit der Differenz zunächst verrechnet. Bis man bei 0 ankommt, müssen also schon einige Euronen verdient worden sein.
Es ist also nicht so, dass das BAFöG-Amt den Studenten den Dreck unter den Fingernägeln nicht gönnt. Es ist sogar eher so, dass die meisten Mitarbeiter dort sehr wohl wissen, dass das Geld für Sprösslinge einkommensschwächerer Familien gedacht ist. Wie viel das kürzlich geerbte Haus der Großmutter heute wert ist, lässt sich nur durch eine Wertermittlung für rund 2.000 Euro feststellen? In solch einem Fall ist das Amt oft sehr kulant und begnügt sich mit Kaufverträgen, die bereits mehrere Jahrzehnte alt sind.
Klischee #4: BAFöG-Mitarbeiter sind unfreundlich und überfordert.
Vielleicht kann man manchen Mitarbeitern vorwerfen, bei dem ganzen Papierwirrwarr den Durchblick zu verlieren. Zu allgemeiner Unfreundlichkeit neigt der gewöhnliche BAFöG-Mitarbeiter aber nicht. Meine persönlichen Sachbearbeiter habe ich stets als hilfsbereit und auskunftsfreudig kennengelernt.
Die meiste Zeit musste ich mich allerdings mit einer telefonischen Beratung zufriedengeben. Das lag einerseits daran, dass die Kürze der Frage (und der Antwort) einen Ausflug zum BAFöG-Amt nicht gerechtfertigt hätte. Zum anderen sind die Sprechzeiten der Mitarbeiter allerdings auch mit denen des Studentensekretariats vergleichbar. Anstatt lediglich zwei Beratungszeiträume wöchentlich zu veranschlagen, würde ich es als sehr viel hilfreicher empfinden, jeden Tag eine Sprechstunde für Studenten anzubieten.
Andernfalls muss die nette Dame vom Info-Point herhalten. Gerade bei spezifischen Fragen muss diese Person allerdings passen – ihr liegt die BAFöG-Akte ja nicht vor. Besonders zu Beginn meiner BAFöG-Karriere nutzte ich dieses Angebot rege. Mein Geld bekam ich trotzdem – irgendwann. Meine persönliche Sachbearbeiterin habe ich tatsächlich erst gegen Ende des zweiten Semesters zu Gesicht bekommen.
Und zum Thema „überfordert“: Über die Förderung wird in aller Regel recht zügig entschieden – sobald der Antrag vollständig vorliegt. Dass dies nicht nur in der Macht des zuständigen Sachbearbeiters liegt, sollte inzwischen klargeworden sein.
Klischee #5: Das BAFöG ist unlogisch.
Würde man dem BAFöG ein Arbeitszeugnis ausstellen, so dürfte die folgende Formulierung auf keinen Fall fehlen: Das BAFöG war stets um eine höchstmögliche Transparenz bemüht. Was auf dem Arbeitsmarkt den Todesstoß bedeuten kann, ist in der Realität fast halb so schlimm. Man sollte sich allerdings darauf einstellen, dass mit jeder Änderungsanzeige ein neuer BAFöG-Bescheid im Briefkasten wartet. Das ist zwar transparent, kann in manchen Fällen aber schnell zu einem regelrechten Papierkrieg ausarten.
Was das BAFöG häufig unlogisch erscheinen lässt, ist sicherlich die Abhängigkeit von anderen Personen. Verdient der Bruder oder die Schwester ein klein wenig zu viel bei der Ausbildung, kann das fatale Auswirkungen auf das BAFöG haben. Die Geschwister zählen dabei zur Bedarfsgemeinschaft der Eltern. Die Logik dahinter: Verdient ein Kind etwas mehr, bleibt genug Geld für das andere Kind übrig.
Unlogisch mutet es vor allem dann an, wenn andere Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld eine größere Bedrohung für das BAFöG darstellen als der Verdienst aus einer geregelten Ausbildung. Erhält ein naher Familienangehöriger tatsächlich mehr Arbeitslosengeld als zuvor Lohneinkommen, kann das gleichbedeutend mit einem Nullbescheid beim BAFöG sein. Echt so passiert in Tübingen…
Ein solcher Vorfall offenbart natürlich nicht nur eine Unlogik hinter dem BAFöG, sondern hinter dem deutschen Sozialsystem als ganzes. Wo liegt bitteschön der Anreiz, arbeiten zu gehen, wenn man als Arbeitsloser mehr Geld erhalten würde? Und wo liegt bitteschön die Logik, wenn zwar das BAFöG erhöht wird, im gleichen Moment aber auch die Beiträge zur studentischen Krankenversicherung steigen? Die faktische Erhöhung des Fördersatzes geht also spurlos an all solchen Studenten vorbei, die sich selbst krankenversichern müssen; also alle ab 25.
Regelrecht unsozial ist allerdings das allseits gefürchtete Formblatt 5. Dieses ist ab dem fünften Fachsemester einzureichen und soll sicherstellen, dass der Antragssteller die Regelstudienzeit einhalten kann. Kann die Uni dies nicht bestätigen, liegt der Student mit seinem Zeitplan also im Verzug, dann – Pech gehabt. Wesentlich sozialer wäre es stattdessen, dafür zu sorgen, dass BAFöG-Bezieher neben dem Studium nicht arbeiten müssten, damit sie auch die Regelstudienzeit einhalten können. Stattdessen werden hier viele Studenten dafür bestraft, dass sie sich ein Zubrot verdienen.
Klischee #6: Das BAFöG ist eine gute Einnahmequelle.
Wer das tatsächlich so sieht, der hat den Sinn des BAFöG nicht verstanden. Beim BAFöG geht es in erster Linie um Förderung, nicht um Finanzierung. Ähnlich wie bei anderen Sozialleistungen geht es nicht darum, Studenten auszuhalten, sondern sie bei ihrer selbstbestimmten Bildung zu unterstützen. Das BAFöG ist dabei jedoch nicht mit allen anderen Sozialleistungen vergleichbar. Man stelle sich nur einmal vor, Hartz-IV – Empfänger müssten ihre Unterstützung zurückzahlen, sobald sie wieder Arbeit gefunden haben.
Ein Schlüsselelement bei der Förderung ist immer der Bedarf. Der tatsächliche Bedarf von Studenten wird vom Gesetzgeber vorgegeben. Die Differenz erhält der Student als BAFöG-Leistung. Problematisch ist dabei allerdings, dass der festgesetzte Bedarf schier in Stein gemeißelt ist – und mit der Realität in vielen Fällen nichts zu tun hat.

Bild: Rainer Halama, Tübingen-Studentenbuden, CC BY-SA 3.0.
So erhalten Studenten, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, einen Zuschuss, um ihre Miete zu bezahlen. Dieser wird bundeseinheitlich aus den durchschnittlichen Mietkosten berechnet. Aktuell liegt er bei 325 Euro. Und nun gehe hin, mein Sohn, und finde ein WG-Zimmer in München, dessen Mietzins diese Summe nicht überschreitet. Durch 0 teilen ist einfacher.
Ähnlich verhält es sich mit dem Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung. Generell müssen sich alle Studenten ab 25 selbst krankenversichern. Die Kosten übernimmt das BAFöG. Naja, nicht ganz. Der Zuschuss liegt bei unter 90 Euro. Aufwändige Recherchen haben allerdings ergeben, dass es in diesem Land keine einzige Krankenkasse gibt, die Studententarife für weniger als 90 Euro anbietet. Der Student bleibt also auf einem Teil der Kosten sitzen.
Als gute Einnahmequelle sollte man das BAFöG tatsächlich nicht betrachten. Dazu ist es auch nicht da. Hinzu kommt, dass es eine sehr unstete Einnahmequelle ist. Die einzelnen Posten werden in jedem Bescheid zwar en détail aufgeführt, viele davon berechnen sich allerdings über ein gesamtes Jahr. Zusätzlich dazu werden viele Faktoren nicht absolut, sondern anteilig oder verhältnismäßig berechnet. Steigt beispielsweise der Verdienst des Nebenjobs um 1 Euro, so heißt das nicht automatisch, dass auch der BAFöG-Anspruch um 1 Euro sinkt. Es bleibt spannend und der nächste Bescheid ist bestimmt wieder eine Überraschung – wenn auch keine erfreuliche.