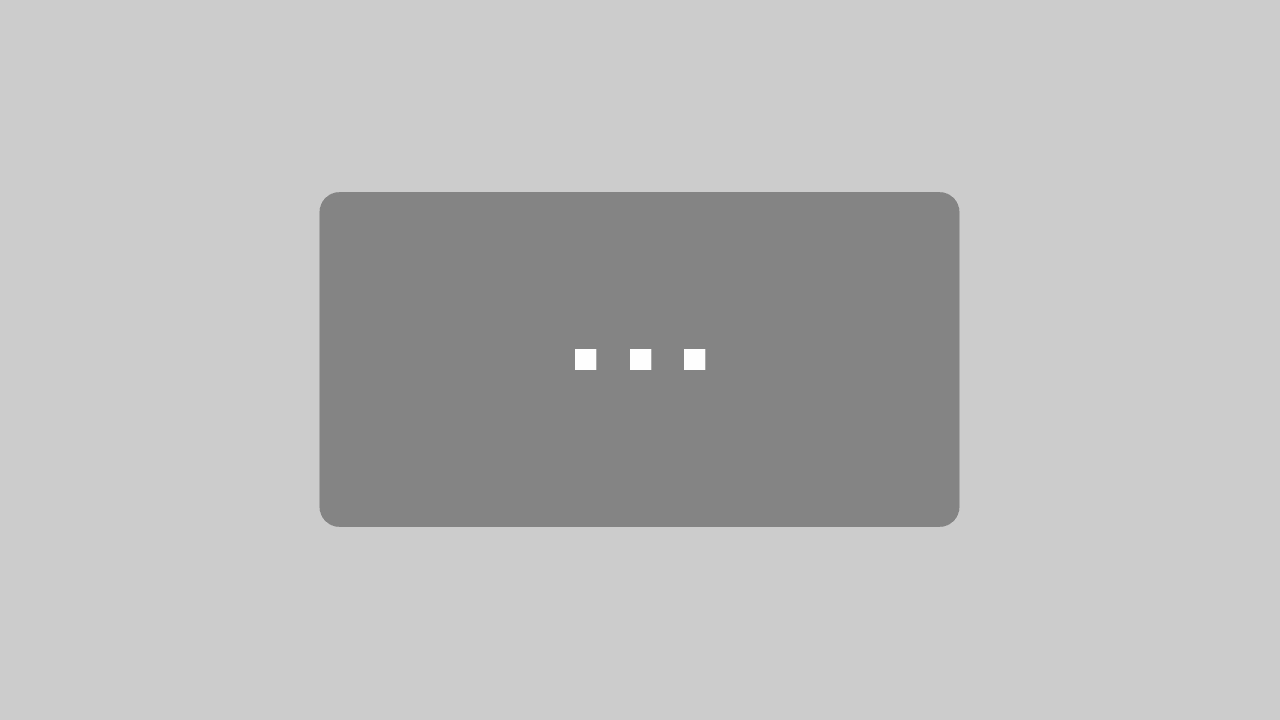Lesedauer: 11 Minuten
Die SPD war einmal eine linke Partei. Was wie ein schlechter Treppenwitz klingt, ist tatsächlich Realität. Und irgendwie ist sie es auch bis heute geblieben. Die wirklich charismatischen und durchsetzungsstarken Politiker der Partei entspringen aber nicht dieser Riege. Sie stehen für Sozialabbau, ein Weiter so und sinkende Wahlergebnisse. Echte linke Politiker melden sich in der SPD viel zu selten zu Wort. Ihre Forderungen sind mit Aufwand verbunden; man hält sie an der kurzen Leine. Vielleicht ist es an der Zeit, das zu ändern.
Galanter Seitenwechsel
Im Herbst 1995 stapft eine beleidigte junge Frau empört aus dem Tagungssaal. Sie tritt vor die Kameras und macht ihrem Ärger Luft. Völlig aufgebracht erzählt sie den neugierigen Journalisten, was für eine Wut sie im Bauch hat. Was war geschehen? Als die 25-jährige Andrea Nahles an diesem Novembermorgen aufgewacht war, da war die Welt noch in Ordnung für sie. Der SPD-Parteitag stand an, inklusive Wahl des Parteivorsitzes. Nahles war sich sicher: Scharping ists’s und Scharping bleibt’s. Dann hielt der amtierende Parteivorsitzende allerdings eine mutlose Rede. Er sprach zwar von Neuanfang, lieferte aber keine konkreten Vorschläge, wie dieser denn vonstattengehen sollte. Beinahe schien es, als hätte sich Scharping auf immer von einer Regierungsbeteiligung der SPD verabschiedet. Immerhin saßen die Sozialdemokraten zu diesem Zeitpunkt bereits seit über einem Dutzend Jahren in der Opposition.
Nahles war stinksauer. Die frischgewählte Juso-Vorsitzende wollte sich mit einem so kraftlosen Kurs nicht zufriedengeben. Trotzig wechselte sie die Seiten – und machte offen Werbung für Scharpings Gegenkandidaten Oskar Lafontaine. Bei der anschließenden Wahl um den Parteivorsitz machte der Oskar dann auch das Rennen und stand fortan an der Spitze der SPD. Nahles war sichtlich zufrieden. Endlich stand wieder ein echter Parteilinker an vorderster Front der Arbeiterpartei.
Viel Lärm um wenig
Viele Jahre zogen ins Land. Andrea Nahles war irgendwann zu alt geworden für die Jungsozialisten. Andere hatten sie abgelöst. Sie selbst war in die Bundespolitik eingestiegen. Vier Jahre lang gehörte sie dem Kabinett Merkel III als Arbeits- und Sozialministerin an. Hatte also endlich die Zeit des linken Flügels in der SPD geschlagen? Schaut man sich Nahles‘ Vermächtnis an, kann man das so nicht sagen. Zwanghaft drückte sie einige urlinke Anliegen gegen den massiven Widerstand der Union in den Jahren 2013 bis 2017 im Bundestag durch. Da war die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns und diverse kosmetische Veränderungen am Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Inhaltlich hat sich die Arbeitsministerin aber dem enormen Druck des Koalitionspartners immer gebeugt. Bis auf den Namen der Gesetzesvorlagen trug keine von ihnen noch die Handschrift der Sozialdemokraten. Der Mindestlohn war ein Minilohn, Leiharbeit wurde für die Betroffenen noch unerträglicher.
Nicht mehr viel war übriggeblieben von der einst rebellischen und unbeugsamen Andrea Nahles, die sich enttäuscht von Parteichef Scharping abgewendet hatte. Auch wenn ihre offene und zumeist unkonventionelle Art etwas anderes vermuten ließ, war sie spätesten mit Eintritt in die Bundesregierung weitaus gemäßigter geworden. Die unberechenbare und unbequeme Brunette, war nun eine Mitstreiterin für das Weiter so geworden.
Fähnchen im Wind
Der Weg, den Andrea Nahles gewählt hatte, war übrigens kein untypischer in der Politik. Auch in vielen anderen Parteien beginnen die Hoffnungsträger von morgen in der Jugendorganisation ihrer Partei. Manche parken dann einige Jahre auf Kommunal- oder Landesebene, bevor sie den Sprung in den Bundestag wagen. Gerade in der SPD erleben wir aber immer wieder, dass mit den kämpferischen Jusos etwas passiert, spätestens wenn sie im Bundestag angekommen sind.
Das Phänomen ist bekannt: In fast jeder Partei ist die Jugendorganisation rebellischer, in manchen Fällen gar revolutionär. Es ist noch nicht lange her, da wurde den Jusos Linksradikalismus unterstellt. Juso-Chef Kevin Kühnert ist da schon einen Schritt weiter und unterstützt mittlerweile Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Ob auch Kevin Kühnert kurz vor knapp die Seiten wechseln und Olaf Scholz die Gefolgschaft kündigen wird? Das bleibt abzuwarten. Derzeit deutet allerdings nichts darauf hin.
Parteivorsitzende ohne Wumms
Und man glaubt es kaum: Selbst systemkonforme Politiker wie Olaf Scholz haben ganz klein bei den Jusos angefangen. Damals hatte er sogar noch ordentlich Haare. Doch nicht nur sein äußeres hat sich im Laufe der Jahre radikal verändert. Immer weiter entfernte er sich von der Parteilinken. Heute verbindet ihn nur noch die zufällige Mitgliedschaft in derselben Partei mit diesem inzwischen kümmerlichen Verein von Traumtänzern.
Denn in die erste Reihe der Politik schaffen es die Linken in der SPD kaum noch. Es gibt sie zwar noch und hin und wieder melden sie sich auch noch zu Wort, einer breiten Öffentlichkeit werden sie aber meist vorenthalten. Der wohl derzeit bekannteste SPD-Politiker des linken Flügels ist Karl Lauterbach. Als Arzt schlug in der Corona-Pandemie seine große Stunde. Immer wieder glänzte er in den vergangenen Monaten mit Fachwissen und guten Ratschlägen. Dass er vor nicht allzu langer Zeit für den Posten des Parteivorsitzenden kandidierte, wissen wohl nicht mehr so viele. Lauterbach hatte seine Kandidatur auch zugunsten von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zurückgezogen.
Er überließ damit zwei völlig unbekannten SPDlern das Feld, vermutlich weil er als Parteilinker nicht genügend Rückhalt in der Partei hatte. Esken ist zwar erklärte GroKo-Gegnerin, aber die wirklich Mächtigen in der Partei sahen in ihr wohl keine allzu große Bedrohung. Nowabo hingegen hat zumindest als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen von sich reden gemacht. Als einer der uncharismatischsten SPD-Vorsitzenden ever spielt er auf Bundesebene aber auch nur eine untergeordnete Rolle.
Es ist Zeit für Gerechtigkeit?
Andere echte Sozialdemokraten wurden von ihrer Partei in den vergangenen Jahren auch immer vorgeschickt und notfalls zur Schlachtbank geführt. Als Bundesumweltministerin hatte es Barbara Hendricks sicher nicht leicht. Mehrere Male wurden ihre guten Ansätze kategorisch abgelehnt und in der Luft zerrissen. Der absolute Gipfel war aber erreicht, als sie bei der Verlängerung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat von CSU-Kollege Christian Schmidt düpiert wurde und eine Meinungsverschiedenheit öffentlich ausgetragen wurde. Die SPD zeigte sich zwar empört, ein großer Aufschrei folgte aber nicht.
Viel eher wurde diese Unverschämtheit stillschweigend hingenommen. Zu groß war wohl die Sorge, die Diskussion um eine Neuauflage der Großen Koalition könnte wieder im Keim erstickt werden. Stattdessen verbannte man Hendricks wieder in Reihe 2 oder 3 der Politik. Das Zepter nahmen andere in die Hand. Martin Schulz zum Beispiel, der in der ersten Jahreshälfte 2017 noch DER Hoffnungsträger für eine Erneuerung der eigenen Partei und einen Neustart der Bundespolitik war. Schulz gehörte beileibe nicht dem linken Flügel der SPD an. Mit seinem Slogan „Es ist Zeit für Gerechtigkeit“ konnte er aber zunächst viele Wähler ansprechen. Da einer echten linken Kehrtwende in der SPD aber der Rückhalt fehlte, wurde Schulz nie konkret. Den weiteren Verlauf kennen wir: Die AfD legte wieder zu, die SPD kassierte ein historisch schlechtes Wahlergebnis.
Union 2.0
Trotzdem war Martin Schulz ein Kandidat, der zumindest anfangs auf den Tisch haute. Er nannte einige Probleme im Land beim Namen und kündigte an, Abhilfe zu schaffen. Sein Nachfolger Olaf Scholz ist da schon ehrlicher. Als großer Verfechter der Agenda 2010 gibt er bisher nicht vor, mehr zu sein als er tatsächlich ist: ein Mainstreamer, ein Politiker des Establishments. Er weiß, dass ihm die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger einen linken Kurs nicht abkaufen würden. Deswegen setzt er auf direkte Konfrontation mit der Union. Nicht weil er ein anderes Angebot hat. Er hat genau das gleiche Angebot, will es aber besser verkaufen. Die Parteispitze macht ihm keine Probleme. Die beiden Pappaufsteller Esken und Nowabo nehmen es hin.
Tatsächlich stiegen die Umfragewerte der SPD nach der Nominierung von Olaf Scholz leicht an. Das ist aber bei Personalwechseln an der Spitze einer Partei kein wirklich seltenes Phänomen. An den Schulz-Hype von 2017 kam der Olaf-Aufschwung jedenfalls bei weitem nicht ran. Was hat also Olaf Scholz nicht, seine Vorgänger aber schon? Haare, könnte man jetzt sagen. Wäre aber irgendwie gemein. Vielleicht sollte man eher fragen, was seine Vorgänger nicht hatten. Dann fällt nämlich, dass gute Umfragewerte und Wahlergebnisse von solchen SPDlern eingefahren wurden, die im Wahlkampf nicht im Bundestag saßen. Sowohl Gerhard Schröder 1998 als auch Martin Schulz vor drei Jahren machten sich die allgemeine Kanzlermüdigkeit zunutze. Eine Wechselstimmung lag in der Luft. Angela Merkel und ihrem politischen Ziehvater Helmut Kohl waren damals wie heute viele Menschen überdrüssig. Sie wollten jemand neues an der Spitze der Regierung.
Beleidigte Leberwürste
Letztendlich scheiterten alle Hoffnungsträger der SPD aus den vergangenen 25 Jahren. Irgendwann fiel auf, dass es mit diesen Menschen keinen Umschwung geben würde, bei dem einen früher, beim anderen später. Doch spätestens seit dem Schulz-Hype von 2017 ist doch klar, dass die Bürgerinnen und Bürger empfänglich sind für Forderungen nach einem höheren Mindestlohn, einer einheitlichen Rente und vielleicht sogar nach einer Vermögensabgabe. Anscheinend haben das auch viele in der SPD verstanden. Und so sind die Sozen seit einigen Monaten um keine linkspopulistische Forderung verlegen.
Aber immer dann, wenn es ein bisschen konkreter wird, blocken die Sozialdemokraten abrupt ab. Mit der Union seien diese Vorhaben schließlich nicht umzusetzen. Das stimmt sogar. Die Hölle friert zu, bevor die Union sich auf eine weitere Einwirkung der Regierung auf den Mindestlohn einlässt. Frech hingegen ist es, dann solche Forderungen zu stellen, wenn man sie im nächsten Moment mit dieser scheinheiligen Tatsache gleich wieder im Sande verlaufen lässt. Beliebte Sätze bei SPD-Bundestagsreden sind: „Wir hätten uns zwar noch mehr vorstellen können, aber…“ oder „Leider ist das mit unserem Koalitionspartner nicht zu machen.“
Gerade diesen letzten Satz halte ich für besonders fatal. Er zeigt zum einen, wie wenig Kampfwillen in der SPD noch steckt, zum anderen suggeriert er eine Schuld des Wählers an den derzeitigen Zuständen. Wie beleidigte Leberwürste berufen sich die Sozen damit auf ihr desaströses Wahlergebnis von 2017. Indirekt sagen sie, es sei die Schuld des Wählers, dass der Mindestlohn nicht angehoben wird und dass die Nachtschwester für eine ganze Etage kranker Menschen allein verantwortlich ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Wählerinnen und Wähler eine solche Politik zwar mittragen würden, von der SPD aber mehr als einmal zu viel über den Tisch gezogen wurden.
Die Notwendigkeit für einen politischen Umschwung ist da, der Wille dazu wächst auch, die Wahlergebnisse der SPD stagnieren aber im günstigsten Fall. Das hat Gründe. Anstatt ihren wenigen treuen Wählern immer wieder einzutrichtern, was mit der Union alles nicht geht, sollten die Sozen lieber umkehren und zeigen, was ohne die Union alles geht.