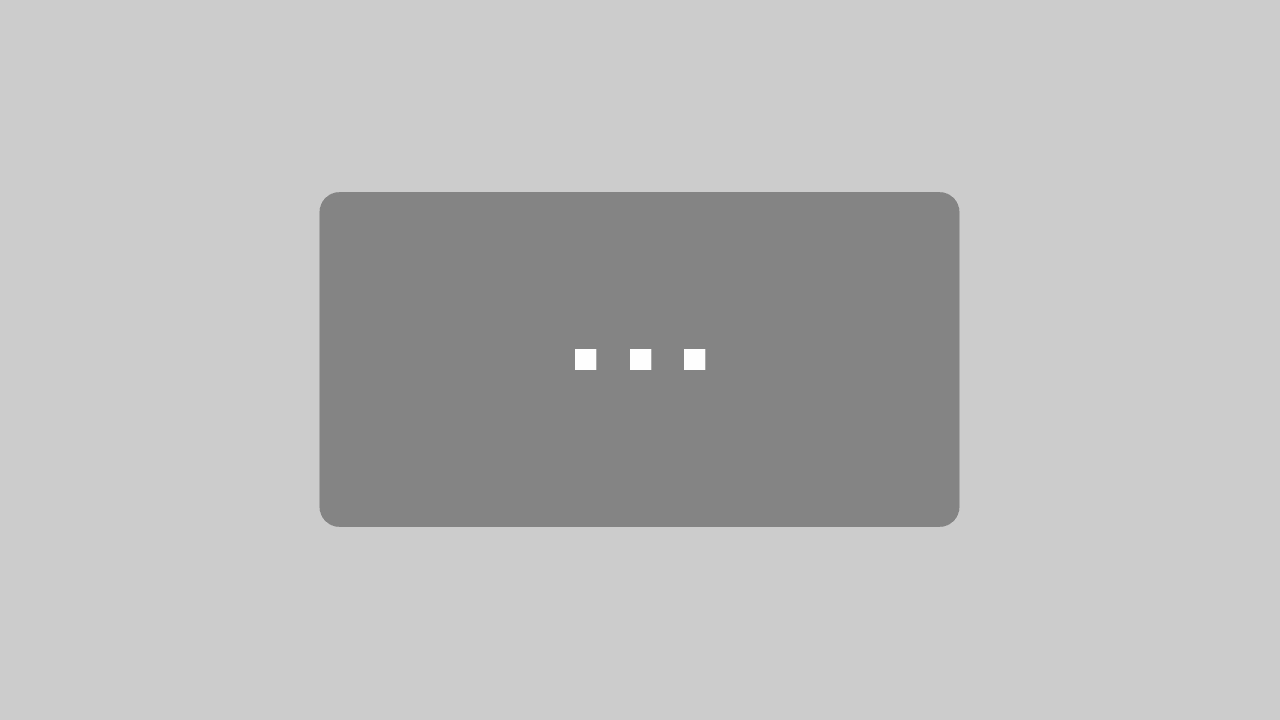Lesedauer: 7 Minuten
Der völkerrechtswidrige Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine schockt die Welt. In diesen schwierigen und unberechenbaren Zeiten ist es wichtig zusammenzustehen. Bei zahllosen Demonstrationen, Friedenskundgebungen und anderen Veranstaltungen haben viele Menschen gezeigt, dass sie den Krieg ablehnen. Sie beweisen Solidarität mit Frauen, Männern und Kindern, die vor Tod und Zerstörung fliehen oder im eigenen Land eingekesselt werden. Einige dieser Bekundungen sind nicht zu Ende gedacht. Manche verfallen dem Irrtum, dass Solidarität mit der Ukraine gleichbedeutend ist mit einer grundsätzlichen Ablehnung gegenüber Russland.
Neue Kontroverse
Seitdem die russischen Truppen am 24. Februar 2022 in die Ukraine eingefallen sind, dominiert dieses Thema die Medien. Fast minütlich vermelden die unterschiedlichsten Kanäle und Nachrichtensender die neuesten Entwicklungen im russischen Krieg gegen die Ukraine. Daneben diskutieren Politiker, Politikwissenschaftler und andere Strategen über die Lage. Sie geben Statements ab oder ordnen die neuesten Geschehnisse in einen Kontext ein.
Nicht alle diese Wortbeiträge werden von der Mehrheit gefeiert. Erst kürzlich machte eine Gruppe linker Abgeordneter von sich reden, als sie sich mit den Kriegsgründen auseinandersetzte. Man warf ihnen Russlandnähe, eine Affinität für Wladimir Putin und ein Verdrehen von Fakten vor.
Genosse der Bosse
Ähnliche Aggressionen bekommt dieser Tage auch ein Mann zu spüren, der sich seit Jahren für ein russisches Wirtschaftsprojekt einsetzt. Sein Engagement für das russische Unternehmen Gazprom und die damit verbundene Nordseepipeline Nord Stream 2 wird Altkanzler Gerhard Schröder nun zum Verhängnis. Seitdem der Konflikt in der Ukraine eskaliert, rufen ihn seine alten Parteifreunde immer wieder dazu auf, sich von Putin zu distanzieren und die Unterstützung des russischen Energielieferanten aufzukündigen.
Im Raum steht nicht weniger als ein Ausschluss aus der Partei. Man wirft dem Ex-Kanzler vor, dass sein Engagement nicht dem Wohlstand Deutschlands diene, sondern auf seine politische Freundschaft mit dem russischen Machthaber zurückzuführen sei. Es stößt vielen hart auf, dass Schröder dennoch eine üppige Pension aus deutschem Steuergeld bezieht. Der „Genosse der Bosse“ hat ein Problem.
Diese Agitationen gegen den früheren Regierungschef sind aber insoweit unehrlich, als dass sich jahrelang kein SPD-Abgeordneter ernsthaft an Schröders fragwürdigen Lobbykontakten gestört hat. Sein Engagement für Gazprom reicht viele Jahre zurück und wurde an der ein oder anderen Stelle sicher kritisiert. Die Vehemenz der Kritik, die Schröder nun entgegenweht, ist aber opportunistisch und unehrlich.
Späte Kritik
Gerhard Schröder ist einer der prominentesten Vertreter des sogenannten Drehtüreffekts. Es ist zwischenzeitlich quasi gute Sitte geworden, dass Politiker nach Ende ihrer Abgeordnetenlaufbahn fast nahtlos in ebenjene Branchen wechseln, mit denen sie zuvor politisch zu tun hatten. Getreu dem Motto „Gezahlt wird später“ holen sie sich in der Wirtschaft den Verdienst ab, der sie als aktive Politiker in die Nähe des Korruptionsverdachts katapultiert hätte.
Von diesem Phänomen profitiert auch die SPD seit vielen Jahren. Mit Gerhard Schröder haben sie sogar einen Pionier dieser dubiosen Praxis in ihren Reihen. Anstatt mit dieser Tradition nun aber für immer zu brechen, monieren sie lieber Schröders unliebsame Verbindungen nach Russland, mit der er so gar nicht in die SPD von heute passt. Es stellt sich die Frage, warum den Sozialdemokraten dieses Licht nicht bereits aufging, als Schröder mit Hartz-IV und anderen Sozialabbauprogrammen um die Ecke kam.
Ein starkes Zeichen
Von jedem wird erwartet, eine Meinung zu dem Krieg in der Ukraine zu haben und diese möglichst auffallend kundzutun. Die zahlreichen Mahnwachen und Friedensdemonstrationen sind ein starkes Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden. Allein in Berlin haben sich an einem Tag rund 500.000 Menschen zusammengetan, um gegen Putins Einmarsch in die Ukraine zu protestieren. Dieses Engagement zeigt deutlich, dass die Menschen den Glauben an Diplomatie und Nachbarschaft nicht verloren haben. Solche Veranstaltungen sind Hoffnungsschimmer in einer viel zu düsteren Zeit.
Die Demonstrationen und Friedensmärsche sind ein ziviles und angemessenes Mittel, auf Russlands Aggressionen zu reagieren. Es ist nachvollziehbar, dass sich auch in Deutschland viele Menschen Sorgen machen. Sie befürchten zwar keinen unmittelbar bevorstehenden Einmarsch russischer Truppen ins Land, aber sie wissen, dass von Russland eine Menge abhängt. Besonders die Aufrechterhaltung einer verlässlichen Energieversorgung steht auf dem Spiel.
Es ist richtig, diese wirtschaftliche Abhängigkeit bei der politischen Einordnung des Konflikts miteinzubeziehen. Es ist ebenso sinnvoll, diese Sorgen beim Protest gegen Putins Krieg nicht außer Acht zu lassen. Jeder weiß, dass uns Putin den Gashahn zudrehen kann und keiner will, dass das tatsächlich geschieht.
Nicht zu Ende gedacht
Es ist insofern schwer nachvollziehbar, wenn sich einige Menschen besonders solidarisch mit der Ukraine fühlen, indem sie für eine Stunde die heimische Heizung abdrehen. Sie wollen Putin zeigen, dass sie sich des Risikos bewusst sind. Das sind sie nicht. Eine Stunde Pulli anziehen ist nichts im Vergleich zur drohenden Versorgungslücke und den horrenden Energiepreisen, sollte Putin ernstmachen. Wer wirklich seine Unabhängigkeit von Russland demonstrieren möchte, der möge seine Heizung nicht nur für einige wenige Stunden abdrehen, sondern für immer.
Im übrigen sind solche öffentlichkeitswirksamen Aktionen kaum geeignet dazu, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Den Ukrainerinnen und Ukrainern ist weitaus mehr geholfen, wenn sie sichere Häfen vorfinden, über sichere Fluchtrouten außer Landes kommen können und anhand des lauten Protests in anderen Ländern sehen können, dass sie nicht allein sind.
Auch ein grundsätzlicher Boykott russischer Unternehmen ist wenig zielführend. Der Europapark in Rust hat kürzlich seine Kooperation mit Gazprom beendet, um Distanz zum russischen Regime zu signalisieren. Besucherinnen und Besucher hatten angekündigt, die beliebte Achterbahn BlueFire nicht mehr zu fahren, weil bereits der vollständige Name der Attraktion auf die Kooperation mit dem russischen Energiekonzern hinweist. Abgesehen davon, dass die wenigsten von der Achterbahn „BlueFire Megacoaster- Powered by Nord Stream 2“ sprechen, sind fast alle russischen Unternehmen dem autokratischen Machthaber unterstellt. Es fehlen schlicht die geeigneten Alternativen.
Unbequeme Position
Die fragwürdige Praxis des Europaparks ist eine Blaupause des politischen Umgangs mit wirtschaftlichen Fragen zu Russland. Der Bau der Nordseepipeline Nord Stream 2 war vielen bereits in den letzten Jahren ein Dorn im Auge. Verschiedene Lobbygruppen und politische Strömungen hatten immer wieder gegen das Wirtschaftsprojekt mit Russland mobilgemacht. Als ihnen die umweltpolitischen Argumente mangels tragbarer Alternativen ausgingen, konzentrierten sie sich auf die politische Dimension. Immer wieder betonten sie, man dürfte mit autokratischen Ländern wie Russland keine Geschäfte machen, weil dort Menschenrechte verletzt werden würden. Es ist bemerkenswert, dass der gleiche Maßstab nicht bei Ländern wie den USA angelegt wird.
Der Krieg in der Ukraine dient diesen Interessensgruppen als willkommene Begründung dafür, das Projekt „Nord Stream 2“ endgültig ad acta zu legen. Fakt ist aber: Wir sind leider nicht in der bequemen Position, dass wir uns aussuchen können, woher wir welche Rohstoffe beziehen. Wir stehen in dieser Frage in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Russland. Es ist richtig, wenn die Bundesregierung nun Maßnahmen ergreift, um den Ausbau erneuerbaren Energien voranzutreiben. Dann könnten wir in Zukunft einen Großteil der benötigten Energie selbst erzeugen. Und dann haben wir auch eine Wahl, ob wir in Zukunft mit Ländern wirtschaftlich zusammenarbeiten, deren politisches System unserem eigenen so offensichtlich zuwiderläuft.